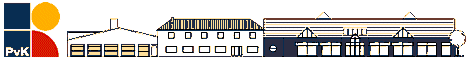Am Ende eines neuen Lebens
Etwa 40 000 Juden flohen zwischen 1933 und 1941 nach Argentinien.
Lennart Laberenz hat einige der letzten noch lebenden Auswanderer besucht.
|

Edith Silber
Wir sind die letzten«, sagt Edith Silber und hält einen Moment inne. »Mit uns sterben die letzten aus dem bürgerlichen deutschen Judentum.« Die 91jährige sitzt im Garten von »Vidalinda«, einem Haus, das deutsche Juden vor 35 Jahren in Buenos Aires für ihresgleichen gebaut haben. Einen angenehmen und selbstbestimmten Lebensabend sollten die Älteren hier verbringen können.
Mit seinen 15 Stockwerken ist »Vidalinda«, zu Deutsch: »schönes Leben«, ein kleines Hochhaus. Er befindet sich ein paar Blocks von der Bahnstation Belgrano R entfernt, wo die Gebäude modern sind und der Verkehr dicht ist. Der Doppelturm von »Vidalinda« hat eine Fassade aus rotem Backstein mit Balkons aus grauen Betonplatten. Ein funktionaler Bau, dessen Inneneinrichtung im Stil der sechziger Jahre dekoriert ist. Die 105 Wohnungen haben jeweils Küche, Schlaf- und Wohnzimmer, dazu gibt es Gemeinschaftsräume. Die Bewohner können die Mahlzeiten im Speisesaal zu sich nehmen oder das Essen in die Wohnung bestellen.
Der Frühlingswind wirbelt durch Edith Silbers weiße Haare und weht ihr immer wieder Strähnen ins Gesicht. Das bürgerliche Judentum in Deutschland, damit meint sie Leute wie ihre Eltern und Großeltern, die sich als Deutsche fühlten, im Ersten Weltkrieg in der kaiserlichen Armee kämpften und über Hitler lachten, wie etwa der Vater: »Was will ein dahergelaufener Österreicher uns sagen, wer Deutscher ist?« empörte sich der einstige Frontsoldat.
»Wie konnten wir uns nur so sicher fühlen?« fragt Edith Silber heute, »die Emanzipation von Juden in Deutschland war nicht einmal 100 Jahre alt«.
Die zerstörte Idylle
Geboren wurde sie im Jahr 1914 im niederrheinischen Lobberich. 1933 absolvierte sie als eine der letzten ihr Abitur in jüdischer Religionslehre. Was bedeutet Heimat, was bedeutet Deutschland für sie, die 1938 Deutschland als Verfolgte verlassen musste? »Als Verfolgte? Vielleicht als Hinausgeschmissene!« erwidert sie energisch. »Eine Heimat habe ich nicht«, sagt sie dann zögerlich, »höchstens eine Erinnerung.« Es sind Erinnerungen an den Hof der Großeltern, an den dortigen Obstgarten, an das Dorf Lobberich, das heute zu Nettetal gehört, an die ländliche Familienidylle und den Kurzwarenladen, den ihre Eltern führten. Der Vater war ein geachteter Mann im Dorf. Katholiken, Protestanten, die Wohlfahrt – alle erhielten von ihm die Jahresspende. Er war eine Dorfgröße, setzte sich sogar erfolgreich für die Änderung des Zugfahrplans ein, damit die Schüler und Arbeiter zwar pünktlich nach Krefeld kamen, aber nicht mehr ganz so früh aufstehen mussten.
1933 ändert sich alles. Noch im selben Jahr schließt sich Edith Silber einer Jugendgruppe an, dem »Schwarzen Fähnlein«, die über den Zionismus diskutiert. Mit ihren zumeist neu gegründeten Vereinen versuchten die Juden, das zu ersetzen, was ihnen das nationalsozialistische Deutschland nicht mehr erlaubte. »Wir wollten vor allem die geistigen und kulturellen Lücken auffüllen, die dadurch entstanden, dass viele von uns ihre Schulen verlassen mussten und nicht mehr an kulturellen Veranstaltungen und Vorträgen teilnehmen durften.« Edith Silber kümmert sich um die Jüngeren. »Die meisten Eltern hatten plötzlich so viele Probleme, dass sie keine Zeit fanden, sich mit den Schwierigkeiten ihrer Kinder zu beschäftigen.« Sie liest den Kindern Geschichten vor, hört ihnen zu, berät sie in alltäglichen Dingen.
Sehr wichtig ist ihr die intensive Freundschaft zum Rabbiner Arthur Bluhm, der oft Besuch von seinen Lehrern Leo Baeck und Martin Buber erhält. Bei den Abendessen sitzt die junge Frau mit am Tisch. Als sie das Abitur bestanden hat, legt Buber den Arm um ihre Schultern und sagt: »Warte noch ein Jahr, bis der Spuk vorbei ist, dann kommst du nach Berlin zum Studium.« Sie will an die Hochschule für jüdische Wissenschaften. Doch der Spuk geht nicht vorbei.
1935 gründet Kurt Julio Riegner in Krefeld eine Gruppe, die die Auswanderung junger Juden organisieren will. Den Organisatoren fällt es nicht leicht, die Älteren zu überzeugen. Als Edith Silber im Sommer 1936 von einem Angehörigen der Gruppe gefragt wird, ob sie als Kinderbetreuerin mitarbeiten will, verbittet sich auch ihr Vater jede Diskussion. »Wir sind doch Deutsche!« ruft er. Die Gruppe bereitet sich zu dieser Zeit auf die Überfahrt nach Lateinamerika vor. Edith Silber macht mit. »Ich wurde gebraucht«, sagt sie und zuckt mit den Achseln. Bis dahin sei ihr Leben in Deutschland erträglich gewesen, »auch wenn wir immer mehr merkten, dass wir nicht dazugehören«.
Mit dem Satz »Ich werde gebraucht« gelingt es ihr schließlich, sich gegen den Widerstand ihres Vaters durchzusetzen. Nur Helmut, ihren kleinen Bruder, den sie gerne mitgenommen hätte, muss sie zurücklassen. Als sie das elterliche Haus im Herbst 1938 verlässt, verabschiedet sich ihr Vater kaum von ihr. Er sitzt weinend im Wohnzimmer. »Ich versuchte, ihn zu beruhigen. ›Ich komme doch bald zurück‹, habe ich noch gesagt.«
Edith Silber kramt aus einem Biedermeiersekretär ein paar handschriftliche Notizen hervor. »Heute war also der heißerkämpfte Tag«, steht unter dem Eintrag vom 23. Oktober 1938. »Erkämpft, da es wirklich nicht einfach war, Behörden und Eltern von der Notwendigkeit und dem Sinn unserer gemeinsamen Auswanderung zu überzeugen. Jeder hatte das Gefühl: Ab heute bist du ein Glied jener Kette von Menschen, die interessiert daran arbeiten, die Auswanderung aus D. zu befördern.«
Ein neues Leben
Von Berlin fahren die 50 Mitglieder der Gruppe nach Triest, von dort geht es mit dem Dampfschiff weiter in Richtung Argentinien, obwohl die argentinische Regierung begonnen hat, die jüdische Einwanderung aus Deutschland einzudämmen. Bei einem Zwischenstopp in Rio de Janeiro lädt ein mitreisender Geschäftsmann Edith Silber und eine Freundin zu einem Stadtbesuch ein. Hier erfahren sie, was gerade in Deutschland geschieht. Es ist der 10. November 1938. Die Gruppe ahnt, dass sie vielleicht länger als geplant im Ausland bleiben muss. »Wir bekamen Angst, weil wir nicht wussten, ob wir unsere Familien wiedersehen würden.« Ediths Silbers Kabine wird zur »Klagemauer«, hier spricht sie ihren Schützlingen Mut zu – eine Aufgabe, die sie lange beibehalten soll.

Der Alltag in Buenos Aires dreht sich um die Arbeit und um die Hoffnung, die Familien nachzuholen. Wie alle anderen besorgt Edith Silber Arbeitsverträge und Referenzen, reicht Anträge beim Einwanderungsamt ein. Haarklein schreibt sie ihren Eltern im Dezember 1941, wie sie sich auf dem Konsulat in Düsseldorf verhalten, was sie anziehen müssten. Vergeblich, die Anträge werden abgelehnt. »Hier gibt es schon zu viele Juden«, entgegnet ihr ein argentinischer Beamter. Ihrem älteren Bruder gelingt die Flucht nach London. Kurz darauf werden die Eltern und ihr kleiner Bruder nach Izbica, ein Außenlager von Auschwitz, deportiert. Von dort erhält sie 1942 einen Brief zurück. »Nicht zustellbar« hat die Reichspost auf den Umschlag gestempelt.
»Seitdem ist Deutschland für mich tot«, sagt Edith Silber. Anfang 1953 fährt sie geschäftlich zur Buchmesse nach Frankfurt, in den achtziger Jahren besucht sie eine Schulfreundin. »Aber ich fuhr zu ihr, nach Deutschland bin ich nie zurückgekehrt.«
Das einzige, was sie weiterhin mit Deutschland verbindet, sind die Sprache und die Literatur. Im Stadtzentrum von Buenos Aires eröffnet sie eine deutsche Buchhandlung, wo sie argentinische Intellektuelle und Künstler wie den Maler Antonio Berni oder den Schriftsteller Jorge Luis Borges kennen lernt.
In den ersten Jahren bleiben die Mitglieder der Gruppe zusammen, sie müssen das vorgestreckte Geld für die Überfahrt, die Visa und das Bestechungsgeld erarbeiten. Irgendwann laufen die Lebenswege auseinander, auch Edith Silber verlässt das Gemeinschaftshaus, »mein späterer Mann fand es nicht schicklich«, sagt sie mit einem ironischen Lächeln. Aber verloren hätten sich die Gruppe und der Gruppengedanke nie.
Dreierlei Deutsche
Anfang der dreißiger Jahre lebten 30 000 Deutsche in Buenos Aires, darunter etwa 400 deutsch-jüdische Familien. Bis 1933 waren sie in die recht wohlhabende deutsche Gesellschaft integriert. Gleichwohl herrschte in der Kolonie schon vor Hitlers Machtantritt eine deutschnationale Stimmung vor. Die Weimarer Republik wurde verabscheut. Kaum hatten die Nazis in Berlin die Macht übernommen, wurden die Juden aus den deutschen Vereinen, Schulen und Organisationen ausgeschlossen. Die Deutsche Bank in Buenos Aires sperrte jüdische Bankkonten. Die Deutschen blieben auch auf dieser Seite des Atlantiks der Heimat treu ergeben.
»Auch in Argentinien war 1933 das Jahr der Rückbesinnung deutscher Juden auf ihr Judentum«, sagt der Psychologe Alfredo José Schwarcz, selbst ein Sohn jüdischer Einwanderer. Die deutschsprachige Kolonie spaltete sich in drei Teile: Neben der erzkonservativen oder nationalsozialistischen Mehrheit gab es eine kleine Gruppe von Kritikern der Nazis – und die deutschsprachigen Juden. Deren Anzahl stieg in den folgenden Jahren, 40 000 kamen zwischen 1933 und 1941.
Die deutschen Juden reagierten auf die Entwicklung in Deutschland und in der deutschen Kolonie und begannen, eigene Vereine und Institutionen aufzubauen. Ein wichtiger Schritt war die Gründung des »Hilfsvereins« im April 1933, der sich später »Asociación Filantrópica Israelita« nannte. Der Verein vermittelte Unterkünfte und Arbeitsgelegenheiten und half den Neuankömmlingen im Alltag. »Man muss dazugehören«, antwortet Edith Silber auf die Frage, warum sie sich im Verein engagierte. Die gleiche Antwort geben Ilse Smilg und ihr Mann José, der mit seinen 81 Jahren heute der »Asociación Filantrópica Israelita« vorsitzt. (...)

José Smilg
In dem Land, das sie aufgenommen hat, wechselten sich im Laufe der Jahrzehnte autokratische Regierungen und Militärdiktaturen ab. Dennoch überlegten die Smilgs nur einmal, Argentinien wieder zu verlassen. Das war 1973 bei der Rückkehr des Präsidenten Juan Perón. »Insbesondere seine erste Präsidentschaft in den fünfziger Jahren trug deutlich faschistische Züge«, erinnert sich José. Aber sie warteten ab und blieben; auf Perón folgte abermals eine Militärdiktatur. »Vielleicht wollten wir manches auch nicht sehen, was um uns herum geschah«, räumt Ilse ein. Man habe sich eben zurückgezogen und »vielleicht die Augen verschlossen«, sagt Edith Silber und will über das Thema nicht weiter sprechen: »Ich bin gerne hier, und ich bin dankbar, dass ich hier überleben konnte.«
Epilog
Anfang dieses Jahres verstarb der letzte deutschsprachige Rabbiner der Stadt, der ebenfalls mit Ediths Gruppe eingewandert war. »Es gibt keine deutschsprachige jüdische Gemeinde mehr, mit uns gehen die letzten«, wiederholt Edith Silber. Sie geht schon lange zu einem spanischsprachige Rabbiner.
In »Vidalinda« werden längst auch osteuropäische und spanischsprachige Juden aufgenommen. In »San Miguel«, dem Altersheim, das die »Asociación Filantrópica Israelita« bereits in den vierziger Jahren in der Nähe von Buenos Aires gründete, wohnen inzwischen auch Nichtjuden. »Wir haben das Heim vor Jahren geöffnet«, sagt José Smilg und beugt sich über das salzlose Mittagessen im Speisesaal, »vor allem aus finanziellen Gründen.« In beiden Institutionen ist das Ende des deutsch-jüdischen Lebens zu spüren. Die Nachfahren der Einwanderer verstehen sich eher als jüdische Argentinier. Edith Silber findet das gut. »Die einzelnen Gruppen der Diaspora mischen sich ab der zweiten und dritten Generation allmählich.«
Der Tee ist kalt geworden, es wird Zeit zu gehen. Edith Silber hat eine bewundernswerte Kondition. Sie will jetzt lesen. Neben ihrem Ohrensessel, hinter dem Biedermeierschrank, stehen, in Leder gebunden, ein paar der wenigen Deutschen, denen sie stets vertrauen konnte: Thomas Mann, Friedrich Schiller und Stefan Zweig. Draußen pulsiert eine andere Welt, die Menschen sprechen eine andere Sprache.
die Spiegelung des Artikels auf www.lobberich.de gestattet. Hierfür herzlichen Dank.
Dies bedeutet aber keine generelle Genehmigung, zur Veröffenlichung auch an anderer Stelle.
Alle Urheberrrechte verbleiben weiter beim Urheber.
Nachtrag 24. März 2011:
Tieftraurig muss ich ihnen (...) mitteilen, dass Edith gestern nacht
nach kurzer Krankheit doch überraschend schnell gestorben ist.
Sie wurde 97 Jahre und hat ihren jüngeren Bruder um knapp zwei Wochen
überlebt.
Sie soll morgen auf dem jüdischen Friedhof begraben werden. (Lennart
Laberenz)
Direkt-Link zum Artikel auf jungle-world.com inm Webarchiv